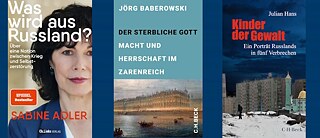Schnell und massiv reagierten die Verlage ab Jahresbeginn auf den Schock des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 und brachten zunächst Neuauflagen von Klassikern (Jean Améry: "Der neue Antisemitismus“, Klett-Cotta; Theodor W. Adorno: "Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute“, Suhrkamp) in die Regale, gefolgt von einer großen Zahl von aktuellen Analysen zum Antisemitismus (Michael Wolffsohn: "Nie wieder? Schon wieder! Alter und neuer Antisemitismus", Herder; Michel Friedman: "Judenhass. 7. Oktober 2023", Berlin Verlag; Philipp Peyman Engel: "Deutsche Lebenslügen. Der Antisemitismus, wieder und immer noch", dtv), aber auch zum Nahost-Konflikt oder zur Geschichte der deutsch-israelischen Beziehung (Joseph Croitoru: "Die Hamas. Herrschaft über Gaza, Krieg gegen Israel", C.H. Beck; Daniel Marwecki: "Absolution? Israel und die deutsche Staatsräson", Wallstein).
Auch die seit einigen Jahren breit debattierte Frage, ob links-liberale intellektuelle und aktivistische Milieus noch progressiv oder schon destruktiv unterwegs sind, also der gesamte sogenannte „Woke“- bzw. „Identitätspolitik“-Komplex, stand teilweise unter dem Eindruck des 7. Oktobers und mancher befremdlicher westlicher Solidarisierungen mit der Hamas: der schmale Essay „After Woke“ von Jens Balzer (Matthes & Seitz) rechnete präzise mit Verirrungen im (eigenen) linken Lager ab und ergänzte damit die gehaltvollen, Empirie gesättigten Analysen von Yascha Mounk ("Im Zeitalter der Identität. Der Aufstieg einer gefährlichen Idee", Klett-Cotta) und Philipp Hübl ("Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht", Siedler).
Besorgnis um den Zustand der Demokratie machte sich ab Mitte des Jahres angesichts der US-Wahlen drüben und der AfD-Erfolge in Ostdeutschland hüben im Buchmarkt breit. Der Jurist Maximilian Steinbeis fragte, wie gut eigentlich westliche Demokratien gegen Demokratiefeinde geschützt sind („Die verwundbare Demokratie: Strategien gegen die populistische Übernahme“, Hanser), die Historikerin Eva Kienholz schrieb "Eine kurze Geschichte der AfD. Von der Eurokritik zum Remigrationsskandal" (Rowohlt) und der Humangeograph Daniel Mullis interessierte sich für den deutschen Rechtsruck vom Standpunkt der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“ aus ("Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten. Die Regression der Mitte", Reclam).
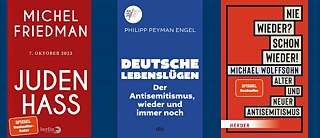
Stets einen Platz auf dem deutschen Buchmarkt finden historische Werke über die NS-Diktatur; dieses Jahr waren in dem Segment besonders eindrücklich Ruth Hoffmanns „Das deutsche Alibi. Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird“ (Goldmann) sowie die umfassende Studie von Tatjana Tönsmeyer „Unter deutscher Besatzung. Europa 1939-1945“ (C.H. Beck). Außerdem ließ sich das Thema durch eine Verschiebung des Blicks auf den Beginn der NS-Zeit auch mit den aktuellen Ängsten über die Fragilität unserer Demokratie verbinden, so etwa bei Volker Ullrich ("Schicksalsstunden einer Demokratie. Das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik“, C.H. Beck) und Jens Bisky („Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934“, Rowohlt). Etwas randständiger aber faszinierend der Band des jüngst verstorbenen
Lutz Hachmeister: „Hitlers Interviews. Der Diktator und die Journalisten“ (Kiepenheuer & Witsch), der zu dem die Gegenwart ebenfalls interessierenden Schluss kommt: Interviews mit Autokraten bringen stets der Allgemeinheit weniger Einsichten als sie den Diktatoren jeweils propagandistisch nützen.
Ganz undiktatorisch schließlich die Autobiographien noch lebender Politiker. Viel gelobt die „Erinnerungen. Mein Leben in der Politik“ von Wolfgang Schäuble (Klett-Cotta). Und mit größtmöglicher Spannung erwartet, der vorläufige Höhepunkt des Sachbuch-Jahres 2024: die Ende November erschienen Memoiren von Angela Merkel (zs. mit Beate Baumann): "Freiheit. Erinnerungen 1954-2021“ (Kiepenheuer & Witsch). Eine Mischung aus feinfühligen Kindheitserinnerungen und mangelnder politischer Selbstkritik, wie Navid Kermani in der Zeit befand.
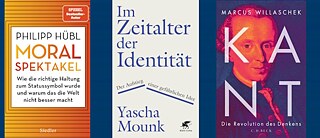
Das Thomas Mann Jahr 2025 fing schon im Herbst 2024 an, sich warm zu laufen (Kai Sina: "Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist“, Propyläen; Heinrich Breloer: "Ein tadelloses Glück. Der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs“, DVA; Oliver Fischer: "«Man kann die Liebe nicht stärker erleben». Thomas Mann und Paul Ehrenberg“, Rowohlt).
Zum Klima wurde auch im Angesicht zunehmender Handlungsohnmacht wieder viel Interessantes und Kritisches geschrieben (Jens Beckert: "Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht“, Suhrkamp; Bernhard Kegel: "Mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawandel", DuMont; Eva Horn: "Klima. Eine Wahrnehmungsgeschichte", Fischer; Armin Nassehi: "Kritik der großen Geste. Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken", C.H. Beck)
Zahlreiche Bücher brachten dem (noch) lesenden Publikum außerdem Chancen, Risiken oder schlicht Funktionen der Künstlichen Intelligenz nahe, höchst gelungen hier etwa Eva Weber-Guskars „Gefühle der Zukunft. Wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern“ (Ullstein).
Ach ja, und zeitlos-schöne Sachen gab es natürlich auch, wie immer. Mich zum Beispiel haben einige elegante Essays glücklich gemacht: Lorenz Engis weiter Bogen von der Entzauberung der Welt bis zum Phänomen Trump ("Die Dramatisierung der Welt. Über Illiberalismus", Claudius); Björn Vedders witzige und bissige Abrechnung mit dem Landleben, das „gemein“ macht ("Das Befinden auf dem Lande. Verortung einer Lebensart", HarperCollins); oder auch Martin Scherers stilistisch brillante Fortsetzung seiner fortgesetzten Beschäftigung mit und Faszination für weitgehend vergessene Sekundärtugenden ("Takt. Über Nähe und Distanz im menschlichen Umgang", zu Klampen).
Catherine Newmark ist promovierte Philosophin und arbeitet als Kulturjournalistin in Berlin. Unter anderem ist sie beim Deutschlandfunk Kultur Redakteurin für geisteswissenschaftliches Sachbuch und für Philosophie sowie Moderatorin der Philosophie-Sendung "Sein und Streit".