Bücherwelt
Romane heute
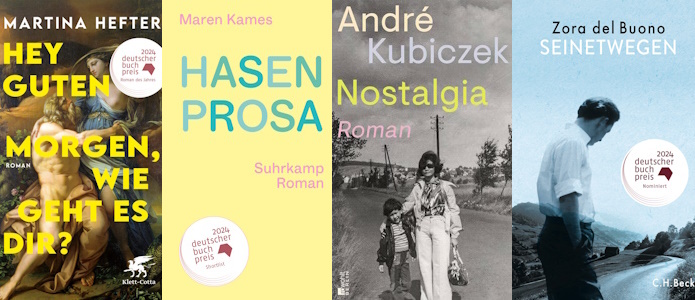
Entdeckungen bei der Juryarbeit für den Deutschen Buchpreis 2024
von Natascha Freundel
Was ist ein Roman in einer Realität, die oft jede Vorstellungskraft sprengt? Welche Möglichkeiten hat literarisches Schreiben heute? Welche Geschichten erzählen wir im deutschsprachigen Raum – über uns und die Welt, in der Demokratie, ja Menschlichkeit extrem gefährdet sind und menschenverachtende Gewalt zu triumphieren scheint? Diese Fragen haben uns in der Jury des Deutschen Buchpreises 2024 immer wieder beschäftigt. Angetrieben aber hat uns die Neugier auf die Themen und Formen der 197 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenig überraschend:
Überrascht hat uns eine Häufung des Zeitreisen-Motivs, hier und da verbunden mit dem Thema Heilung, das wie ein Echo des hundertjährigen Zauberberg-Romans durch die Gegenwartsliteratur hallt. Und wo bleibt die weite oder nahe liegende Welt, wo finden die Krisen und Kriege unsrer Zeit einen Nachhall? Wir haben einige Romane von Autorinnen und Autoren für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert, weil sie auf ganz unterschiedliche Weise auf die Frage antworten, welche Möglichkeiten das literarische Erzählen in einer Realität hat, die oft jede Vorstellungskraft sprengt.
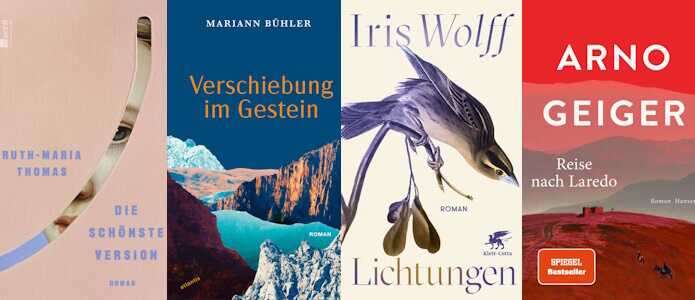
Autofiktion ist Legion
Vielleicht bringt die Tatsache, dass „der Begriff der Krise selbst schon in die Krise gekommen ist“ (Armin Nassehi) und Russlands Krieg gegen die Ukraine unsere Krisen exponentiell potenziert, eine allgemeine Überforderung mit sich und das Bedürfnis, sich wenigstens der eigenen Erfahrungen und Erinnerungen zu versichern. Vielleicht geht der ungebrochene Trend zur Autofiktion aber auch mit einem Ich-Kult der Social-Media-Kultur einher? Wie auch immer, uns haben besonders diejenigen autofiktionalen Romane angesprochen, die literarisch versiert mit dem beliebten Genre spielen. Martina Hefter, unsere Preisträgerin, aber auch etwa Maren Kames schöpfen aus ihrem eigenen Leben und schaffen zugleich eigenständige Kunst: Hefter, indem sie u.a. den Ich-Kult in sozialen Netzwerken parodiert und Ausbeutungsverhältnisse bis nach Afrika thematisiert; Kames, indem sie mit einem Hasen Auto-motorisiert Haken durchs autobiographische Gelände schlägt und nach einer neuen, keinesfalls ein-eindeutigen Sprache sucht.
Leerstellen provozieren oft Recherchen und Imaginationen: André Kubiczek vergegenwärtigt das zu kurze Leben seiner Mutter in der DDR und ihre letzte Reise in ihr Heimatland Laos kurz vor ihrem Tod 1986. Sein Roman ist eines der Bücher dieses Jahres, die die DDR weder skandalisieren noch romantisieren. Ostdeutschland als gebrochener Erfahrungsraum für brüchige Identitäten spielt etwa auch bei Ruth-Maria Thomas, Franz Friedrich, Katja Oskamp, Patricia Hempel oder Domenico Müllensiefen eine wichtige Rolle, Zora del Buono wiederum bricht zu einer Recherche in die Alpendörfer der Schweiz auf, um den frühen Tod ihres Vaters bei einem Verkehrsunfall zu rekonstruieren. Mit ihr erfahren wir viel über die Anzahl von Verkehrstoten, zugleich aber auch über den Mann, der mit einem schicken Schlitten ihren Vater aus dem Leben riss und vermutlich seither unter dieser Schuld litt. Mehrere Adoptivgeschichten, wie etwa bei Franz Dobler oder Ulrike Draesner, geben Raum für Reflexionen über Familie, Zugehörigkeit und Wahlverwandtschaft.
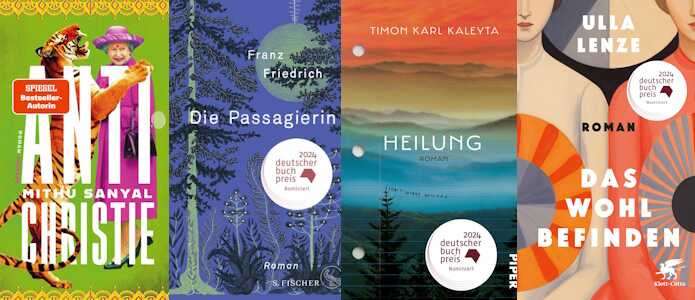
Starke Frauen
Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Thema, das in der deutschsprachigen Romanlandschaft von einer noch recht jungen Stimme direkt angesprochen wird: Ruth-Maria Thomas gelingt es, diese Suche mit dem Thema sexualisierter Gewalt zu verbinden, sodass die Täter-Opfer-Perspektive einige Fragen offenlässt. Auch bei Lana Lux, Laura Leupi oder Barbara Rieger ist männlich dominierte Gewalt in Beziehungen ein zentrales Thema. Mariann Bühler schafft Figuren, die in scheinbar felsenfesten Dorfstrukturen Geschlechtergrenzen überschreiten. Mehrere Romane erzählen von Männern in der Krise und stärkeren Frauen: auch bei Iris Wolff, die eine Kindheitsliebe kapitelweise rückwärts erzählt. Er ist im Heimatdorf in Rumänien geblieben, während sie bald nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes nach Westeuropa gegangen ist und sich als Straßenmalerin durchschlägt. Wolff, die den jungen Mann erzählen lässt, führt dabei in die rumänische Vergangenheit zurück und zugleich jede identitätspolitische Einordnung ihrer Figuren ad absurdum. Den vielleicht konsequentesten Roman über die Krise der Männlichkeit hat Arno Geiger geschrieben, mit der Traumreise eines abgedankten Königs auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.
Zeitreisen
Wer viele Romane nacheinander liest, entdeckt eigentümliche Korrespondenzen zwischen den Büchern. Zu den Möglichkeiten der Literatur gestern und heute gehören Zeitreisen, etwa wenn uns Mithu Sanyal aus dem London der Gegenwart in ein „India House“ Anfang des 20. Jahrhunderts katapultiert und über revolutionäre Gewalt in Befreiungsbewegungen und postkolonialistische Debatten nachdenken lässt. Franz Friedrich wiederum hat einen philosophischen Zeitreiseroman über ein Sanatorium namens Kolchis geschrieben, das Menschen aus allen Epochen zusammenbringt, die vor einem frühzeitigen Tod gerettet wurden. Er springt etwa von Thomas Müntzer auf dem 5-Mark-Schein der DDR zum Bauernkrieg im 16. Jahrhundert und zur Frage, ob Geschichte determiniert ist oder korrigiert werden kann.
Krankheit und Heilung
Von einem Sanatorium erzählen auch Timon Karl Kaleyta oder Ulla Lenze. Während Kaleyta ein exklusives Sanatorium à la Zauberberg parodiert, in dem ein Mann ohne Eigenschaften Heilung von seiner (nicht nur sexuellen) Impotenz sucht, stellt Lenze erstmals die Geschichte der Beelitzer Heilstätten bei Potsdam literarisch dar. Wie Lenze geht auch Jan Schomburg dem Spiritismus der Zwanziger Jahre nach.
Doris Wirth schildert das Abdriften eines Familienvaters in eine gewaltige und gewaltvolle Psychose ohne Aussicht auf Heilung, Markus Berges führt uns autofiktional in eine Münsterländer Frauenpsychiatrie und seine erste Liebe zu einer psychotisch Kranken. Paula Fürstenberg erzählt von Sorge und Pflege unter Freunden, Jan Kuhlbrodt vom Denken, Lesen und Schreiben mit einem zunehmend schwächeren Körper. Martina Hefter ist Kuhlbrodts Lebensgefährtin; ihre Romane sind stilistisch und auch inhaltlich sehr verschieden und geben doch, zusammen gelesen, einen unvergesslichen Eindruck von den sozialen, psychischen und physischen Barrieren kranker Menschen in unserer angeblich so barrierefreien Welt.

Demokratie oder Diktatur
Die Zwanziger- und Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts sind oft Referenzen in den politischen Debatten heute. Nora Bossong schildert die Verführungskraft des Faschismus aus den Augen eines homosexuellen Mitläufers, den Magda Goebbels, die Frau des NS-Propagandaministers, unwiderstehlich fasziniert. Markus Thielemann lässt die Gespenster der Nazi-Vergangenheit wortwörtlich aufleben. In den scheinbar zeitlosen Alltag einer Schäferfamilie in der Lüneburger Heide brechen nicht nur Wölfe ein, sondern auch Neue Rechte und der ruhelose Geist einer ermordeten NS-Zwangsarbeiterin.
Die Realität der Kriege
Wenige, je für sich herausragende Romane thematisieren die Kriegsrealität unserer Zeit. Michael Köhlmeier erkundet die leninistisch-stalinistisch-putinistisch-paranoide russische „Seele“ in einem Roman, der zugleich die Möglichkeiten literarischer Wahrheit hinterfragt. Clemens Meyer verbindet in einem Opus Magnum die Jugoslawienkriege mit den Verfilmungen der Karl May-Romane und führt uns Projektionen männlicher Heldenmythen vor Augen. Ronya Othmann zeigt, was ein Völkermord bedeutet, konkret der Genozid an den Jesiden durch den selbsternannten „Islamischen Staat“ vor genau zehn Jahren; auch für die Literatur: Die Sprache stößt hier an eine unüberwindbare Grenze. Wo Gewalt triumphiert, versagt die Kunst. Und doch können wir auf das Erzählen, Schreiben und Lesen nicht verzichten.
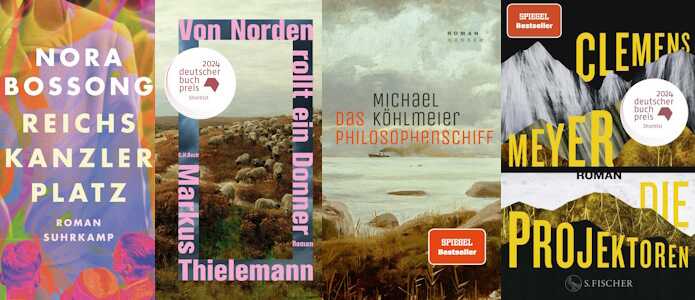
P.S. Dystopien… … sind ebenfalls in vielen Büchern zu finden: bei Jasmin Schreiber, Johanna Grillmayer, Helwig Brunner, Andrea Grill, Bernhard Kegel, Elias Hirschl oder auch Thea Mengeler. Doch ob Klimakrise oder KI, die beste literarische Form für das Ende der Welt muss nach Eindruck der Jury wohl noch gefunden werden.
Natascha Freundel ist Redakteurin bei radio3 vom rbb und Moderatorin im Debatten-Podcast „Der zweite Gedanke“. Von 2010 bis 2018 war sie Redakteurin bei NDR Kultur in Hannover und Hamburg, zuvor berichtete sie als freie Journalistin und Literaturkritikerin aus Berlin, Israel und der Ukraine für die ARD Kulturwellen und verschiedene Zeitungen, u.a. „Berliner Zeitung“, „Frankfurter Rundschau“ und „Die Zeit“. 2024 war sie Sprecherin der Jury des Deutschen Buchpreises.
Erwähnte Bücher:
- Nora Bossong: Reichskanzlerplatz. Suhrkamp
- Markus Berges: Irre Wolken. Rowohlt Berlin
- Helwig Brunner: Flirren. Literaturverlag Droschl
- Mariann Bühler: Verschiebung im Gestein. Atlantis Verlag
- Zora del Buono: Seinetwegen. C.H. Beck
- Franz Dobler: Ein Sohn von zwei Müttern. Tropen
- Ulrike Draesner: zu lieben. Penguin Verlag
- Franz Friedrich: Die Passagierin. S. Fischer
- Paula Fürstenberg: Weltalltage. Kiepenheuer & Witsch
- Arno Geiger: Reise nach Laredo. Hanser
- Andrea Grill: Perfekte Menschen. Leykam Verlag
- Johanna Grillmayer: That's life in Dystopia. Mary Salzmann Verlag
- Martina Hefter: Hey guten Morgen, wie geht es dir? Klett-Cotta
- Patricia Hempel: Verlassene Nester. Tropen
- Elias Hirschl: Content. Paul Zsolnay Verlag
- Timon Karl Kaleyta: Heilung. Piper
- Maren Kames: Hasenprosa. Suhrkamp
- Bernhard Kegel: Gras. Dörlemanm
- Michael Köhlmeier: Das Philosophenschiff. Hanser
- André Kubiczek: Nostalgia. Rowohlt Berlin
- Jan Kuhlbrodt: Krüppelpassion - oder Vom Gehen. Gans Verlag
- Ulla Lenze: Das Wohlbefinden. Klett-Cotta
- Laura Leupi: Das Alphabet der sexualisierten Gewalt. März Verlag
- Lana Lux: Geordnete Verhältnisse. Hanser Berlin
- Thea Mengeler: Nach den Fähren. Wallstein Verlag
- Clemens Meyer: Die Projektoren. S. Fischer
- Domenico Müllensiefen: Schnall dich an, es geht los. Kanon Verlag
- Katja Oskamp: Die vorletzte Frau. park x ullstein
- Ronya Othmann: Vierundsiebzig. Rowohlt
- Barbara Rieger: Eskalationsstufen. Verlag Kremayr & Scheriau
- Mithu Sanyal: Antichristie. Hanser
- Jan Schomburg: Die Möglichkeit eines Wunders. dtv
- Jasmin Schreiber: Endling. Eichborn Verlag
- Markus Thielemann: Vom Norden rollt ein Donner. C.H. Beck
- Ruth-Maria Thomas: Die schönste Version. Rowohlt Hundert Augen
- Doris Wirth: Findet mich. Geparden Verlag
- Iris Wolff: Lichtungen. Klett-Cotta