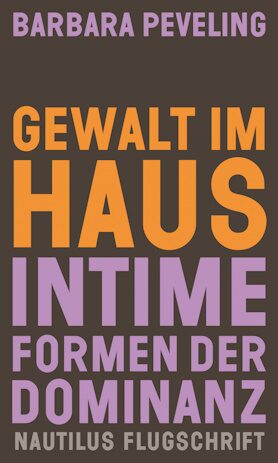Barbara Peveling Gewalt im Haus. Intime Formen der Dominanz
- Edition Nautilus
- Hamburg 2024
- ISBN 978-3-608-98826-3
- 320 Seiten
- Verlagskontakt
Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.
Das Kernkraftwerk der intimen Gewalt
So ist das Haus in diesem Buch der Ort eines selbst erfahrenen ebenso wie der eines allgemeinen, sozusagen strukturellen Horrors. Als Kind hat Peveling im Elternhaus den Selbstmord des Vaters erleben müssen, Folge und Kulmination einer toxischen Männlichkeit, die der Vater selbst eher erleidet als genießt. Dass der Vater sich das Leben nimmt und der Rest der Familie nach ihm aufräumen muss, erscheint ihr als ultimative Geste der Sorglosigkeit: für „care“ sind eben stets die weiblichen Angehörigen zuständig. Später im Leben, als junge Ehefrau und Mutter, erlebt Peveling, wie sich die Muster häuslicher, intimer Dominanz an ihr wiederholen. Da ist ein Ehemann, der keine Familienarbeit leisten will, weil ihn die Zwänge des Berufslebens hindern, und da ist seine Frau, die sich darin übt, die eigenen Berufs- und sonstigen Wünsche hintanzustellen und dabei gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die vielzitierte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie kommt bei der Frau und nur bei ihr als „mental load“ an. Aber auch der Wille zur Selbstausbeutung schützt sie und die Familie nicht vor männlicher, oft nur verbaler, dann auch physischer Gewalt. Muss das so sein, fragt sich die Autorin fast quälend, ein ums andere Mal. Ist ihre Bereitschaft, sich lange Zeit ins eigene Unglück zu fügen, ein Indiz für eigene „bad choices“ oder eher für objektive Gewaltverhältnisse, wie sie seit je im Hause herrschen und alle in Mitleidenschaft ziehen, die darin leben? Oder für beides?
Peveling zieht eine Menge ganz unterschiedlichen Materials heran, um ihre These vom Haus oder „oikos“ als Ursprung allen familiären Übels zu untermauern. Das Haus als arbeitsteiligen Wirtschafts- und Lebensort der Großfamilie gibt es, seitdem die Menschheit sesshaft wurde. Ob freilich die Frau im Haus strukturell als Opfer des Patriarchats gelten kann, ist zumindest umstritten (wenn auch nicht bei Peveling). Als sich in der frühen Neuzeit die männliche Berufswelt ausdifferenziert und damit auch Werkstatt oder Geschäft räumlich Abstand nehmen vom eigenen Haus, rückt die Frau zur eigentlichen Herrin über Haus und Gesinde auf. Mit der bürgerlichen Kleinfamilie wird dann der strenge Haus- und Familienvater wieder ins Recht gesetzt. Aber im eigenen Haus macht, worauf Peveling hinweist, gerade der patriarchale Mann stets eine unglückliche Figur, die häufig Gewaltausübung nach sich zieht. Erst wenn er, im Zuge weiterer Emanzipationen, Haushalt und Familie wirklich zur eigenen Sache erklärt, ist oder wäre der Fluch der männlichen Gewalt im Haus zu überwinden. Peveling erzählt in ihrem Buch, wie sie eines Tages, und viel zu spät, einen Schlussstrich unter die erlittene intime Dominanz setzt und mit ihren Kindern Haus und Mann verlässt. Hat das Haus, wenn es derart von Gewalt vergiftet ist, überhaupt eine Zukunft? Sollte man nicht besser einen Betondeckel darüberstülpen wie über ein leckes Kernkraftwerk? Pevelings Buch entwirft das Bild einer neuen Intimität, in der die Wunden heteronormativer Häuslichkeit geheilt wären. Nach Auszug von Frau und Kindern bliebe dann wohl der wütende Mann allein und hilflos im Haus übrig – eine beunruhigende Vorstellung. Sollten es dann Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Männer und Männer, Frauen und Frauen, befriedet, aufgeklärt und entgiftet, nicht doch noch einmal mit dem Zusammenleben versuchen, vielleicht sogar im eigenen Haus?

Von Christoph Bartmann
Christoph Bartmann war Leiter der Goethe-Institute in Kopenhagen, New York und Warschau und lebt heute als freier Autor und Kritiker in Hamburg.
Inhaltsangabe des Verlags
Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet – doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Barbara Peveling schreibt auch über all die Formen häuslicher Gewalt, die darunter liegen, die eng verbunden sind mit traditionellen Geschlechterrollen, ökonomischer Ungleichheit und dem Haus als intimer Arena der Dominanz. Dabei spricht sie als Betroffene: Sie hat als Kind zwischen ihren Eltern und als Erwachsene in ihren Beziehungen Gewalt erlebt. Sie zeigt auf, dass die Strukturen der Dominanz allen schaden, auch Männern wie ihrem Vater, der als Täter die Gewalt letztlich gegen sich selbst richtete. Ein aufrüttelnder Essay über die Zyklen der Gewalt, über Schweigen und Scham, Gegenwehr und Hoffnung.
(Text: Edition Nautilus)